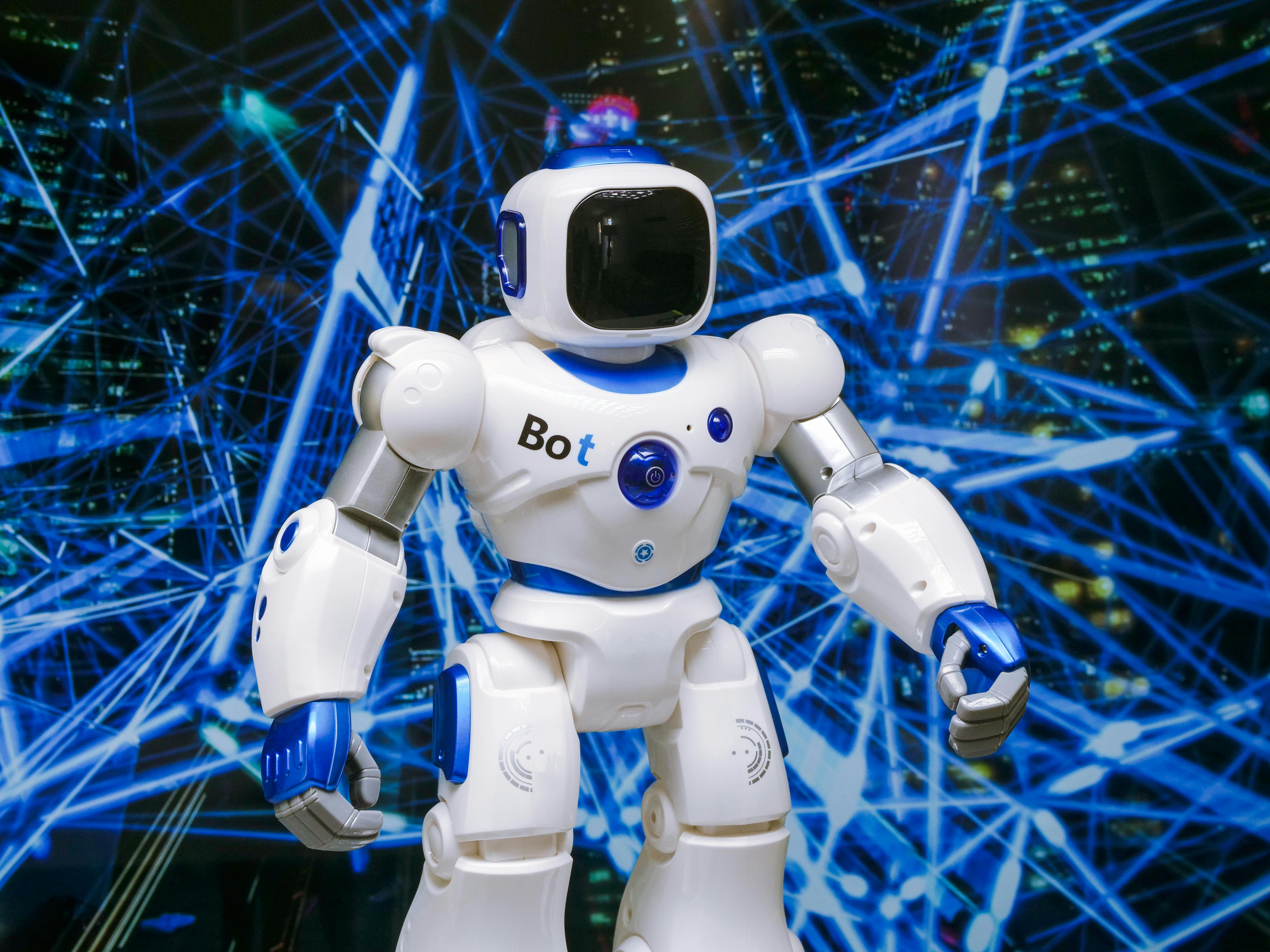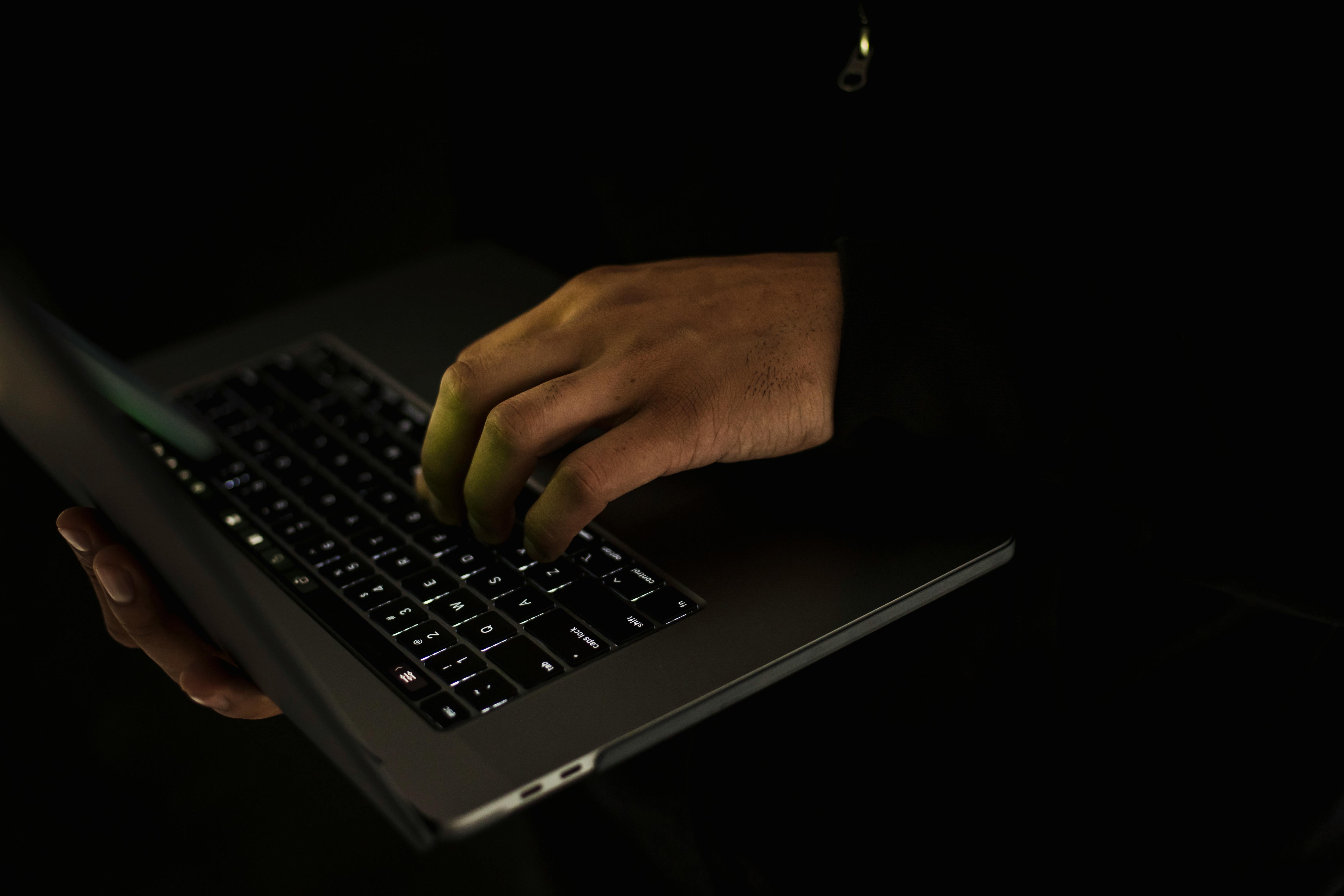Forderungen nach einer Urheberpauschale für KI in Deutschland

KI sauber im Unternehmen integrieren: Der 5-Schritte-Plan
Von der ersten Idee bis zur voll integrierten KI-Lösung – strukturiert, sicher und mit messbarem Erfolg
Strategie & Zieldefinition
Wir analysieren Ihre Geschäftsprozesse und identifizieren konkrete Use Cases mit dem höchsten ROI-Potenzial.
✓ Messbare KPIs definiert
Daten & DSGVO-Compliance
Vollständige Datenschutz-Analyse und Implementierung sicherer Datenverarbeitungsprozesse nach EU-Standards.
✓ 100% DSGVO-konform
Technologie- & Tool-Auswahl
Maßgeschneiderte Auswahl der optimalen KI-Lösung – von Azure OpenAI bis zu Open-Source-Alternativen.
✓ Beste Lösung für Ihren Fall
Pilotprojekt & Integration
Schneller Proof of Concept mit nahtloser Integration in Ihre bestehende IT-Infrastruktur und Workflows.
✓ Ergebnisse in 4-6 Wochen
Skalierung & Team-Schulung
Unternehmensweiter Rollout mit umfassenden Schulungen für maximale Akzeptanz und Produktivität.
✓ Ihr Team wird KI-fit
Inhaltsverzeichnis
Optimieren Sie Prozesse, automatisieren Sie Workflows und fördern Sie Zusammenarbeit – alles an einem Ort.
Das Wichtigste in Kürze
- Die deutschen Länder fordern eine gesetzliche Urheberpauschale für die Nutzung geschützter Werke durch Künstliche Intelligenz (KI).
- Ein Diskussionspapier der Rundfunkkommission der Länder skizziert einen "Digitale-Medien-Staatsvertrag" (DMStV), der einen Vergütungsanspruch für das Training und den Einsatz generativer KI vorsieht.
- Ziel ist ein Lizenzmodell, das durch Verwertungsgesellschaften einen fairen Ausgleich zwischen Innovation und den Interessen der Rechteinhaber, insbesondere aus dem journalistisch-redaktionellen Bereich, schaffen soll.
- Zusätzlich zu Vergütungsansprüchen werden Transparenzpflichten für KI-Anbieter und Maßnahmen zum Schutz journalistischer Inhalte gefordert.
- Die GEMA hat bereits ein Zwei-Säulen-Lizenzmodell vorgestellt, das sowohl das KI-Training als auch die Folgenutzung von KI-generierten Inhalten vergüten soll.
Hintergrund der Debatte: KI und Urheberrecht
Die rasante Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) stellt das bestehende Urheberrecht vor neue Herausforderungen. Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Claude werden mit riesigen Datenmengen trainiert, die oft urheberrechtlich geschützte Werke umfassen. Die Frage, wie Urheber für die Nutzung ihrer Werke in diesem Kontext angemessen vergütet werden können, ist eine zentrale Diskussion, die sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene intensiv geführt wird.
Die deutschen Länder haben sich in dieser Debatte positioniert und fordern die Einführung einer Urheberpauschale für die Nutzung geschützter Inhalte durch KI. Diese Initiative zielt darauf ab, die kommunikativen Grundlagen einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft im digitalen Zeitalter zu sichern und einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen von KI-Entwicklern und Kreativschaffenden zu gewährleisten.
Die Forderungen der Länder: Ein "Digitale-Medien-Staatsvertrag"
Die Rundfunkkommission der Länder hat ein Diskussionspapier für einen "Digitale-Medien-Staatsvertrag" (DMStV) vorgelegt. Dieses Papier enthält umfassende Maßnahmen, die sich mit den Herausforderungen des KI-Zeitalters auseinandersetzen. Ein Kernpunkt ist die Einführung eines eigenständigen, gesetzlichen Vergütungsanspruchs für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke.
Zentrale Elemente des vorgeschlagenen Vergütungsmodells
- Gesetzlicher Vergütungsanspruch: Es soll ein klar definierter, gesetzlicher Anspruch auf Vergütung für die Nutzung geschützter Werke beim Training und Einsatz generativer KI-Systeme etabliert werden.
- Kollektive Wahrnehmung: Die Abwicklung der Vergütung soll über Verwertungsgesellschaften erfolgen. Dies soll eine effiziente und faire Verteilung der Einnahmen an die Rechteinhaber ermöglichen.
- Transparenzpflichten: KI-Anbieter sollen verpflichtet werden, detailliert offenzulegen, welche Werke für das Training ihrer Modelle verwendet wurden, insbesondere wenn die Nutzung über eine bloße Zusammenfassung hinausgeht. Eine Kennzeichnungspflicht für Crawler und Bots wird ebenfalls angestrebt.
- Schutz journalistischer Inhalte: Die Länder wollen Inhalteanbieter, die nach journalistischen Standards arbeiten, besonders schützen. Dies beinhaltet die Forderung nach Diskriminierungsverboten, die verhindern sollen, dass journalistische Inhalte aufgrund von Paywalls oder externen Links in ihrer Auffindbarkeit benachteiligt werden. Es soll ein gleichberechtigtes Ausspielen von recherchierten und redaktionell verantworteten Inhalten gegenüber ausschließlich KI-generierten Inhalten auf Plattformen gewährleistet werden.
- Medienrechtliche Verantwortung von Chatbot-Betreibern: Chatbot-Betreiber sollen in die medienrechtliche Verantwortung genommen werden, insbesondere wenn ihre Systeme einem eigenen Inhalteangebot gleichkommen. Dazu gehören verpflichtende Quellenangaben, Verlinkungen und Plausibilitätschecks.
Bestehende Regelungen und ihre Grenzen
Die EU-Urheberrechtsnovelle hat Ausnahmen für Text- und Data-Mining (TDM) festgelegt, die in Deutschland im Urheberrechtsgesetz umgesetzt wurden. Demnach ist die Vervielfältigung von rechtmäßig zugänglichen digitalen Werken für das Training von Algorithmen erlaubt, um Informationen über Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen. Diese Berechtigung gilt jedoch nur unter bestimmten Bedingungen für Forschungseinrichtungen, die keine kommerziellen Zwecke verfolgen dürfen.
Angesichts der zunehmenden kommerziellen Nutzung generativer KI-Systeme sehen die Länder die Notwendigkeit, diese TDM-Regeln zu überprüfen. Ein wichtiger Aspekt ist der Nutzungsvorbehalt, der es Rechteinhabern erlaubt, die Nutzung ihrer Werke für TDM ausdrücklich auszuschließen. Für die Wirksamkeit dieses Vorbehalts sind klare formelle Vorgaben erforderlich.
Der Deutsche Kulturrat hatte bereits zuvor eine angemessene Vergütung für die KI-Nutzung geschützter Werke gefordert und darauf hingewiesen, dass die TDM-Schranke in vielen Fällen nicht greife. Die Nutzung von Werken für das KI-Training wird von einigen als Urheberrechtsverletzung angesehen, da sie massenhaft und ohne ausreichende Rechtsgrundlage erfolge.
Ökonomische und rechtliche Modelle zur Vergütung
Die Debatte um eine Urheberpauschale wirft die Frage nach der praktischen Umsetzung und der Berechnung der Vergütung auf. Verschiedene Modelle werden diskutiert, um eine faire Beteiligung der Kreativschaffenden zu gewährleisten.
Das Zwei-Säulen-Lizenzmodell der GEMA
Die GEMA hat ein Lizenzmodell vorgestellt, das eine faire Beteiligung von Musikschaffenden an den Erträgen von KI-Anbietern sicherstellen soll. Dieses Modell basiert auf zwei Säulen:
Erste Säule: Vergütung für KI-Training
- Dieses Modell richtet sich an Anbieter generativer KI-Dienste, die auf dem deutschen Markt tätig sind.
- Es sieht eine Grundbeteiligung von 30 Prozent der Netto-Einnahmen vor, die durch das generative KI-Modell oder -System erwirtschaftet werden.
- Die Lizenzgebühren beinhalten eine Mindestvergütung, die an die Menge des generierten Outputs angepasst ist, um auch bei geringen oder keinen wirtschaftlichen Vorteilen eine Beteiligung zu sichern.
- Die Lizenz ist unabhängig vom Ort des Trainings und an den Output gebunden, was die systematische Erfassung und Auswertung des Weltrepertoires der Musik als intensive Nutzungsform anerkennt.
Zweite Säule: Beteiligung bei der Folgenutzung
- Diese Säule betrifft die Lizenzierung der Folgenutzung von KI-generierten Inhalten, beispielsweise als Hintergrundmusik in Videos.
- Es wird argumentiert, dass auch KI-generierte Musik schutzfähige Elemente der Werke enthält, mit denen das KI-Modell trainiert wurde.
- Die Vergütung soll mindestens so hoch sein wie bei von Menschen geschaffenen Werken, um eine angemessene Beteiligung der Rechteinhaber an den Einnahmen durch KI-generierte Songs zu gewährleisten.
Berechnungsmodelle für die Pauschale
Ökonomen schlagen Beteiligungsmodelle vor, die sich an der Nutzungsintensität orientieren. Eine Möglichkeit wäre eine proportionale Vergütung der Urheber, basierend auf der Häufigkeit ihrer Werke im Trainingsmaterial. Automatisierte Systeme könnten den Anteil jedes Werkes ermitteln und die Pauschale entsprechend ausschütten. Dies würde sicherstellen, dass häufig genutzte Werke stärker vergütet werden.
Internationale und europäische Perspektiven
Die EU arbeitet an der Umsetzung des sogenannten AI Acts, der Transparenzpflichten für KI-Anbieter vorsieht. Diese müssen künftig offenlegen, mit welchen Daten ihre Systeme trainiert wurden. Dies könnte eine Grundlage für nationale Pauschalmodelle schaffen. Eine EU-weite Lösung wird als wichtig erachtet, um Fragmentierung und Rechtsunsicherheit zu vermeiden, da KI-Modelle grenzüberschreitend entwickelt und genutzt werden.
Auch international gewinnen ähnliche Diskussionen an Bedeutung. In den USA gibt es Sammelklagen gegen KI-Unternehmen wegen der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke ohne Lizenz. In Großbritannien wird geprüft, ob bestehende Pauschalvergütungsmodelle auf KI-Trainingsdaten übertragen werden können.
Herausforderungen und Kritik
Die Einführung einer Urheberpauschale ist mit verschiedenen Herausforderungen und Kritikpunkten verbunden.
Rechtliche Unsicherheiten
Ein zentrales Problem ist die urheberrechtliche Einordnung von KI-generierten Inhalten. Nach deutschem Recht können nur natürliche Personen Urheber sein. Dies wirft Fragen auf, wem die Rechte an einem Text gehören, der mithilfe einer KI erstellt wurde, und wann der Anteil der Maschine so groß ist, dass die menschliche Schöpfungshöhe entfällt. Besonders hybride Werke, die aus menschlicher und maschineller Kreativität entstehen, sind schwer einzuordnen.
Hemmung der Innovation vs. fairer Ausgleich
Kritiker befürchten, dass eine solche Abgabe Innovationen hemmen und Start-ups benachteiligen könnte. Die praktische Umsetzung, insbesondere die Erfassung der tatsächlich genutzten Werke, wird als aufwendig und technisch schwierig angesehen. Zudem ist unklar, wie globale Plattformen rechtlich zur Zahlung einer nationalen Pauschale verpflichtet werden könnten.
Befürworter argumentieren hingegen, dass ein fairer Ausgleich notwendig ist, um die Existenz von Kreativschaffenden zu sichern und die Wertschöpfung in der Kultur- und Kreativwirtschaft zu erhalten. Sie sehen die aktuelle Situation als einen "Raubzug gegen die Kreativen", der gestoppt werden müsse.
Transparenz und Verantwortung
In der öffentlichen Diskussion wird oft eine Beweislastumkehr gefordert: KI-Unternehmen sollen nachweisen müssen, dass sie die Zustimmung für jedes genutzte Werk besitzen. Ein funktionierendes "Opt-out"-System, das Urhebern erlaubt, ihre Inhalte aus KI-Trainingsdaten herauszunehmen, ist derzeit kaum praktikabel. Die Forderung nach besseren Kennzeichnungspflichten für KI-generierte Inhalte und mehr Transparenz bei den Trainingsdaten unterstreicht das Bedürfnis nach Vertrauen und Nachvollziehbarkeit.
Die Ablehnung einiger großer Technologiekonzerne, den freiwilligen EU-KI-Verhaltenskodex zu unterzeichnen, verstärkt die Skepsis gegenüber moralischen Appellen und unterstreicht die Notwendigkeit klarer gesetzlicher Vorgaben.
Ausblick
Die Frage, wann eine Urheberpauschale für KI in Deutschland eingeführt wird, bleibt offen. Die Länder haben den Druck auf die Bundesregierung erhöht, konkrete Gesetzesvorschläge vorzulegen. Experten gehen davon aus, dass frühestens 2026 mit einer Umsetzung zu rechnen ist, möglicherweise im Rahmen einer größeren Urheberrechtsreform auf EU-Ebene.
Neben der Pauschalvergütung werden auch alternative Modelle wie Lizenzdatenbanken diskutiert, in denen Urheber ihre Werke freiwillig registrieren können und KI-Unternehmen Nutzungsrechte erwerben müssten. Diese Lösungen könnten Pauschalen ergänzen oder langfristig ersetzen, erfordern jedoch einen hohen Aufwand und Kosten.
Die Debatte um eine Urheberpauschale für KI ist eine komplexe Auseinandersetzung zwischen technologischer Innovation und dem Schutz geistigen Eigentums. Eine faire Lösung erfordert transparente Offenlegung der genutzten Trainingsdaten, eine nachvollziehbare Vergütung für Urheber, eine technisch praktikable Umsetzung ohne unnötige Bürokratie und eine internationale Abstimmung, um Schlupflöcher zu vermeiden. Das Ziel ist es, Künstliche Intelligenz als Werkzeug zu nutzen, ohne die schöpferische Vielfalt und die wirtschaftliche Grundlage der Kreativschaffenden zu gefährden.
Bibliography: - heise online: Länder wollen Urheberpauschale für KI. Verfügbar unter: https://www.heise.de/news/Laender-wollen-Urheberpauschale-fuer-KI-10868956.html - Einfach-Genial: Länder wollen Urheberpauschale für KI. Verfügbar unter: https://einfach-genial.de/node/5287 - N.A.D.R. Redaktion: Länder fordern Urheberpauschale für KI. Verfügbar unter: https://www.nadr.de/aktuelles/politik/laender-fordern-urheberpauschale-fuer-ki/ - NewsParadiese: Länder wollen Urheberpauschale für KI. Verfügbar unter: http://newsparadies.de/index.php?PHPSESSID=ed5bib48ooir5vagnhkguadok3&/topic,1435013.0.html - heise online: KI-Nutzung geschützter Werke: Kulturrat fordert angemessene Vergütung. Verfügbar unter: https://heise.de/news/Kulturrat-fordert-angemessene-Verguetung-fuer-KI-Nutzung-geschuetzter-Werke-10242694.html - BackstagePRO: Faire Beteiligung von Kreativen: GEMA stellt Lizenzmodell für generative KI vor. Verfügbar unter: https://www.backstagepro.de/thema/faire-beteiligung-von-kreativen-gema-stellt-lizenzmodell-fuer-generative-ki-vor-2024-10-29-y87hkDSQq9 - GEMA: KI und Musik: GEMA fordert Beteiligung von Musikschaffenden an Erträgen der KI-Anbieter und präsentiert erstes Lizenzmodell. Verfügbar unter: https://www.gema.de/de/w/gema-praesentiert-erstes-ki-lizenzmodell - GEMA: Zwei Säulen ein Ziel: Effektive KI-Lizenzierung für eine faire Beteiligung der Musikschaffenden. Verfügbar unter: https://www.gema.de/de/w/generative-ki-lizenzmodell-zwei-saeulen - FAZ: KI und Urheberrecht: Der Kampf um den Schutz von Kreativberufen. Verfügbar unter: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kuenstliche-intelligenz/ki-und-urheberrecht-der-kampf-um-den-schutz-von-kreativberufen-110455000.html - FAZ: Länder wollen Reform des Urheberrechts. Verfügbar unter: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/laender-wollen-reform-des-urheberrechts-110519834.html
.svg)

.png)